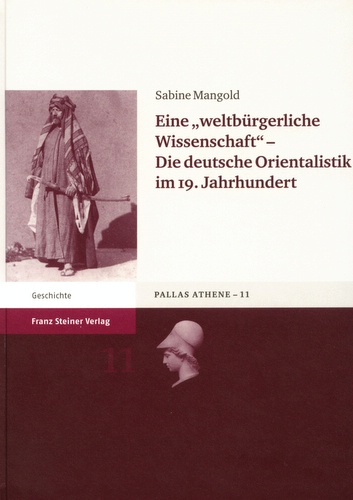Eine "weltbürgerliche Wissenschaft" -
Die deutsche Orientalistik im 19. Jahrhundert
Die Orientalistik gilt heute als exotisches Orchideenfach. Dieses Urteil kursierte bereits im 19. Jahrhundert. Trotzdem gehörte das Fach bis zum Ersten Weltkrieg zur festen Grundausstattung der Philosophischen Fakultäten. Die vorliegende Studie geht daher der Frage nach, wie es der Orientalistik in Deutschland gelang, sich im Geflecht von Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit an den Universitäten nicht nur zu etablieren, sondern langfristig zu verankern. Wie gingen die deutschen Orientalisten mit dem Vorwurf um, eine "Luxuswissenschaft" zu sein, und worin begründete sich dieser?
Neben der Entwicklung der Orientalistik an den deutschen Universitäten stehen Gruppen- und Schulbildungen, methodische Entscheidungen sowie die Tätigkeit außeruniversitärer Institutionen im Mittelpunkt.
II. Zwischen Neuanfang und Tradition: Von der Hilfswissenschaft der Theologie zur eigenständigen Disziplin
1. Die Orientalischen Studien in Europa um 1800
a) Die traditionelle Anbindung an die Theologie
Die Orientalischen Studien konnten in Deutschland wie im restlichen Europa um 1800 bereits auf eine lange "vorkritische"(80) Epoche zurückblicken, in der das Fach noch keine eigenständige Disziplin bildete.(81) Schon die Orientalisten des frühen 19. Jahrhunderts setzten diese Vorgeschichte der "eigentlichen Studien des Orients und seiner wissenschaftlichen Schätze"(82) mit deren Anbindung an die Theologie gleich: "Die Periode der Abhängigkeit aber nennen wir die, wo die orientalischen Sprachen und Literatur nur als Hilfswissenschaft im Dienste der Bibelerklärung und zur Verbreitung der christlichen Religion bearbeitet und studiert wurden."(83) Um der Mission willen hatten sich europäische Gelehrte bereits seit dem Mittelalter mit den orientalischen Sprachen und dem Koran als dem heiligen Buch des Islam beschäftigt. Obwohl die Anfänge des orientalistischen Studiums an den deutschen Universitäten teilweise bis ins 15. Jahrhundert zurückreichten(84), erwachte das eigentliche Interesse daran in Deutschland erst nach der Reformation. Folglich waren es hier im wesentlichen die protestantischen Universitäten, die sich der Orientalia annahmen, während die katholischen Hochschulen den Unterricht in den orientalischen Sprachen eher vernachlässigten. Die entstehenden orientalistischen Professuren, die in der Regel bereits der Philosophischen Fakultät angehörten, wurden übereinstimmend "der alttestamentlichen Exegese bestimmt"(85) "(I)nprimis librorum Biblicorum lectione"(86) darin bestand z. B. den Statuten der Philosophischen Fakultät der Universität Greifswald von 1545 zufolge die Aufgabe des professor linguarum orientalium. Entsprechend sollte der orientalistische Unterricht die Grundlagen der orientalischen Sprachen vermitteln und darauf aufbauend in die Bibelexegese einführen.
Das Hebräische als Sprache des Alten Testamentes bildete dabei naheliegenderweise jahrhundertelang den Ausgangs- und Mittelpunkt des orientalistischen Sprachstudiums.(87) Hinzu kamen sehr bald Aramäisch und Chaldäisch bzw. Syrisch sowie Arabisch, letzteres jedoch nur als "Hilfswissenschaft zur Erlernung des Hebräischen."(88) In Anlehnung an dieses Unterrichtsrepertoire galten noch bis an die Schwelle zum 19. Jahrhundert das "arabische hebräische und chaldäische" als "die orientalischen Sprachen.(89) "Orientalist war dazumal in Deutschland schon wer mit dem Hebräischen und Aramäischen sich abgab; sogar das Arabische wurde vorherrschend nur der Bibel wegen, also einseitig und dürftig gelernt"(90), faßte der Göttinger Professor für orientalische Sprachen Heinrich Ewald 1837 nicht ohne einen Unterton der Geringschätzung das Sprachvermögen seiner Vorgänger gegen Ende des 18. Jahrhunderts zusammen. Ihrer Aufgabe entsprechend hatten die Orientalisten vor 1800 in erster Linie Sprachlehrer und Exegeten zu sein. Ihre Veröffentlichungen beschränkten sich in der Regel auf Grammatiken und Lehrbücher für den Unterrichtsgebrauch und stellten meist Kompendien älterer Werke dar, die von ihnen mit neuen Zusätzen und Anmerkungen versehen wurden. Daneben traten die Lehrer der orientalischen Sprachen mit exegetischen Einführungen in die Bücher der Bibel auf. Mit ihnen reihten sie sich eindeutig in den Kreis der Theologen ein. Solange Unterricht und Erforschung der orientalischen Sprachen ausschließlich im Dienste der Theologie standen, blieben auch die materiellen Grundlagen und Lehrmittel über die Jahrhunderte hinweg weitgehend unverändert. Für das Arabische beispielsweise griff man noch in den zwanziger Jahren des 19. Jahrhunderts zum arabisch-lateinischen Lexikon des Holländers Jacob Golius (1596-16679(91) von 1653; und bevor 1810 die neue Grammaire arabe des französischen Orientalisten Silvestre de Sacy erschien, beherrschte die Grammatica arabica des Thomas Erpenius (1584-1624) (92) von 1613 fast "zwei Jahrhunderte lang unbestritten den Unterricht im Abendlande."(93) Als Textgrundlagen für den Sprachunterricht dienten neben der hebräischen Bibel, rabbinischer Literatur und christlich-religiösen Schriften vor allem der Koran und die Hadith-Sammlungen, also die Überlieferungen der Aussprüche des Propheten Muhammad.(94) Daneben waren seit dem 17. Jahrhundert in Europa auch Texte aus dem Bereich der Philosophie und Medizin sowie arabische Grammatiker und Historiker bekannt, unter denen Abū l-Fidā' (1273-1331) (95) an erster Stelle rezipiert wurde.(96) Doch diese Texte wurden eher selten im Unterricht herangezogen und interessierten die theologisch orientierten Orientalisten an den deutschen Universitäten kaum. "Obgleich damals schon einige Jahrhunderte lang mit Eifer getrieben," so resümierte wieder Heinrich Ewald mit Blick auf die morgenländische Wissenschaft des ausgehenden 18. Jahrhunderts, "hatten sich diese Studien in Europa doch noch nicht weit von der Bibel als ihrem alten Ausgangspuncte entfernt."(97) An den deutschen Universitäten sollte diese traditionelle Abhängigkeit auch nach der Jahrhundertwende weiterbestehen. Wie der hessische Innen- und Justizminister Freiherr Karl Wilhelm Heinrich du Bos du Thil (1777-1859) (98) 1833 in einer Denkschrift an die Gießener Universität konstatierte, blieb "das Verhältnis der Professur der orientalischen Sprachen als einer vorzugsweise exegetischen (...) in den ersten Jahren des 19. Jahrhunderts dasselbe, das es in dem 18. Gewesen."(99) Obwohl die Orientalischen Studien damit bis ins frühe 19. Jahrhundert an die Theologie gebunden blieben, zeichneten sich seit der Mitte des 18. Jahrhunderts doch eine Reihe von Veränderungen und Neuansätzen ab, die ihre künftige Verselbständigung, d. h. ihre inhaltliche Emanzipation von der Theologie sowie ihre methodische Verwissenschaftlichung, vorbereiteten.
b) Die Entdeckung der orientalischen Literatur und Geschichte als eigenständiges Forschungsgebiet
Angeregt und verstärkt durch die Aufklärung, die "in der kritischen, relativierenden Wendung gegen die eigene etablierte Welt (...) andere, außereuropäische Kulturen in den Blick" (100) nahm, belebte sich, befördert durch eine wachsende Zahl von Reiseberichten, in der gebildeten Öffentlichkeit seit dem frühen 18. Jahrhundert das weltliche Interesse an der Literatur, Geschichte und den wissenschaftlichen Errungenschaften des Orients. Außerhalb der Universitäten äußerte sich diese neue Orientbegeisterung in den unterschiedlichsten künstlerischen Modeerscheinungen.(101) Auf dem Gebiet der Literatur befriedigte vor allem die erste Übersetzung der Geschichten aus Alf layla wa-layla, Tausend und einer Nacht, des Franzosen Antoine Galland (erschienen 1704-1717) das Bedürfnis nach orientalischem Exotismus. (102) Die zuweilen grausamen und erotischen Märchen aus dem arabischen Volksroman fanden jenseits der akademischen Welt bei einem gebildeten Publikum Anklang, das den Orient nicht mehr ausschließlich als Schauplatz der Bibel betrachtete, sondern ihn als Herkunftsort luxuriöser Handelswaren und als mächtiges, wenn auch nicht mehr bedrohliches Reich des osmanischen Sultans schätzte. Grundsätzlich nahm die Aufklärung den Orient erstmals als gleichwertigen Teil der Weltgeschichte und Ausdruck der menschlichen Kultur wahr. Die akademische Orientalistik war auf dieses "von theologischen Vorurteilen befreite Interesse" für den Orient und seine Literatur "seitens der europäischen Bildungswelt" jedoch "nicht vorbereitet."(103) So blieb es zunächst die Sache von Gelehrten außerhalb der universitären Tradition, den europäischen Leser mit der orientalischen Literatur vertraut zu machen und ihm Geschichte und Kultur des Orients näher zu bringen.
Eine eigentümliche, ebenso rühmliche wie tragische Rolle spielte dabei "der geniale deutsche Autodidakt"(104) Johann Jacob Reiske (1716-1774) (105) Auf Reiske gehen einige der bedeutendsten Ausgaben und Übersetzungen bis dahin unbekannter arabischer Autoren zurück, die auch von den Orientalisten des 19. Jahrhunderts noch verwendet wurden. So lieferte er 1742 die erste Ausgabe und Übersetzung der Mū `allaqa des arabischen Dichters Tarafa (106) und 1754 die lateinische Übersetzung der Annalen des Abū l-Fidā. (107) Besonders mit seiner Mū'allaqa-Ausgabe, die lange vor der Romantik die europäische Begeisterung für orientalische Poesie belegt, setzte er dabei neue, zukunftsweisende Maßstäbe für die Edition und Übersetzung orientalischer Literaturwerke. Doch Reiske unterschied sich nicht nur in diesen methodischen Fragen von seinen Zeitgenossen. Anders als sein ehemaliger Mitschüler, der Professor für orientalische Sprachen an der Göttinger Universität Johann David Michaelis (108), vertrat er ein neues Orientalistik-Konzept, das mit dem der Universitäten und der von ihnen favorisierten Anbindung an die Theologie nichts mehr gemeinsam hatte. Für Reiske beinhaltete die Beschäftigung mit den Sprachen und der Literatur des Orients keinen Dienst an der "heiligen Philologie". Sie war ihm nach eigenem Bekunden gleichgültig (109) Statt dessen kam es ihm darauf an, aus der Literatur "die Geschichte, Beredsamkeit und Dichtkunst" (110) des Orients ohne Rücksicht auf den Nutzen für die Bibelexegese kennenzulernen. (111) Reiske trat so als erster nicht nur für das selbständige Studium der orientalischen Literatur ein, sondern verband damit zugleich das Studium der Geschichte der islamischen Welt. Sie erschien ihm als Teil der Menschheitsgeschichte mindestens ebenso interessant und lehrreich wie die europäische Geschichte. Nicht zu unrecht gilt der Leipziger Arabist daher als Begründer der Historiographie der islamischen Welt. In seiner Textauswahl knüpfte Reiske an das seit dem 17. Jahrhundert aus dem Geist der Aufklärung erwachsene Interesse an philosophischen, geographischen und historischen Texten an und ergänzte sie durch die reiche orientalische Poesie. Außerdem stand bei ihm bereits das Arabische, und nicht mehr das Hebräische, im Mittelpunkt seiner Arbeit und diente dazu, die reichen Quellen zur islamischen Geschichte und Kultur zu entdecken. Für Reiske, den Protagonisten einer neuen Orientalistik-Konzeption, traf tatsächlich zu, was der Brockhaus von 1853 für die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts verallgemeinernd feststellte: "Man wollte nun diese Sprachen nicht mehr blos wegen biblischer und missionarischer Zwecke kennen lernen, sondern auch um die darin erhaltene Literatur und aus dieser die Bildung und die Geschichte der morgenländ. Völker zu erforschen." (112) Während Reiske für diesen neuen Ansatz von berühmten Gelehrten des 18. Jahrhunderts wie Lessing oder Herder hochgeschätzt wurde, traf er mit seinen Bestrebungen, die orientalischen Studien aus dem HiIfsdienst für die philologia sacra zu lösen, innerhalb der akademischen Orientalistik nur auf Unverständnis. Der vehemente Widerstand, den ihm die Professoren für orientalische Sprachen, allen voran Michaelis und der holländische Orientalist Albert Schultens (1686-17509 (113), entgegen setzten, verhinderte Reiskes universitäre Karriere und machte ihn, wie er es selbst ausdrückte, zum "Märtyrer der orientalischen Literatur."(114) Sein Scheitern verdeutlicht eindrucksvoll, wie ausschließlich sich die universitäre Orientalistik in Deutschland (und auch Holland) Mitte des 18. Jahrhunderts noch über die Anbindung an die Theologie legitimierte.
In England übernahm William Jones (1746-1794) (115) eine vergleichbare Rolle wie Reiske in Deutschland. Allerdings fand er in seiner Heimat eine viel größere Resonanz und wurde zudem nicht von der dortigen Universitätsorientalistik angegriffen. Der englischen Tradition des Gentleman-scholar verpflichtet, lebte Jones sich ebenfalls autodidaktisch in das Studium der orientalischen Sprachen und Literatur ein. Mit Reiske teilte er die Aufmerksamkeit für die altarabische Poesie, die durch beide um die Mitte des 18. Jahrhunderts als eigenständige Literaturgattung in Europa eingeführt wurde. Die Vorliebe für die Dichtung entsprang dabei übrigens nicht allein dem europäischen Geschmack und Interesse an der Poesie als "Ursprache" der Völker, sondern ergab sich aus der besonderen Liebe des Orients zur Dichtung - genauso, wie auch die Märchen und das Märchenerzählen zur orientalischen Tradition gehören.
Berühmt wurde Jones zunächst durch sein Werk Poeseos asiaticae Commmentariorum libri sex (1774) und seine 1783 erschienene englische Übersetzung der Mū'allaqāt, der berühmtesten Gedichtsammlung vorislamischer Poesie. Darüber hinaus machte er Europa mit der indischen Literatur vertraut. Als ausgebildeter Jurist ging Jones 1783 nach Indien an den obersten englischen Gerichtshof in Fort William zu Kalkutta und begann dort, indische Geschichten und Mythen aus dem Sanskrit ins Englische zu übersetzen. Ähnlich beeindruckt wie Goethe (116) reagierte die gesamte europäische Geisteswelt des späten 18. Jahrhunderts auf die Entdeckung dieser bis dahin unbekannten und für die Bibelexegese irrelevanten Sprache und Literatur. (117) In Indien gründete Jones gemeinsam mit einigen anderen gelehrten Liebhabern des Sanskrit 1784 zudem die erste Organisation zur Förderung der Orientalischen Studien und der Verbreitung orientalischer Literatur. Die Asiatic Society of Bengal wurde zur "Mutter anderer ähnlicher Vereinigungen" (118) in der ganzen Welt.
(Auszug aus Kap. II (a) -(b) ebd. S.29-34)